Von Elisabeth Olliges, PD Dr. med Reiner Dahlbender und Martina Leser
Lesedauer: 7 Minuten
Die interprofessionelle, mehrdimensional-milieutherapeutische Behandlung des Departements für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (DPP) der Klinik Barmelweid ist wirksam. Das Departement sammelt kontinuierlich bio-psycho-soziale Informationen von seinen Patientinnen und Patienten, um die Behandlungsqualität jährlich zu überprüfen. Dies geschieht durch Fragebögen, in denen die Patientinnen und Patienten sich sowohl vor dem Eintritt in die Klinik als auch beim Austritt selbst beurteilen. Im Blog-Interview analysieren Dr. rer. biol. hum. Elisabeth Olliges und PD Dr. med. Reiner Dahlbender die gesammelten Daten.
Welche Patientinnen und Patienten kommen in das Department für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie?
Elisabeth Olliges: Blickt man auf die 772 Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2024 im DPP waren, ergibt sich eine bemerkenswerte Altersspanne von 16 bis 92 Jahren, mit einem Durchschnittsalter von 45 Jahren. Interessanterweise waren zwei Drittel Frauen. Besonders in der Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen war der Frauenanteil mit 81 Prozent sehr hoch, während er in den älteren Altersgruppen bei etwa 60 Prozent lag.
Das klingt nach einer sehr heterogenen Gruppe. Könnten Sie uns etwas zu den sozialen Umständen der Patientinnen und Patienten sagen?
Elisabeth Olliges: Ja, gerne. Die grosse Heterogenität setzt sich hier fort: 13 Prozent der Patientinnen und Patienten waren vor dem Eintritt in die Klinik bereits pensioniert oder erhielten eine AHV-Rente. Mehr als 60 Prozent waren vor dem Eintritt voll- oder teilweise arbeitsunfähig. Zwei Drittel der Patientinnen und Patienten waren bereits vor dem Klinikaufenthalt krankgeschrieben; 36 Prozent sogar seit mehr als sechs Monaten. Gleichzeitig gibt es aber auch eine grosse Gruppe von 28 Prozent, die vor Beginn der stationären Behandlung gearbeitet haben.

Und spricht der hohe Prozentsatz an Arbeitsunfähigkeit denn auch für eine erhebliche Beeinträchtigung im Alltag? Wie geht es den Patientinnen und Patienten, was berichten sie über ihren Gesundheitszustand vor dem Klinikeintritt?
Elisabeth Olliges: Viele Patientinnen und Patienten fühlen sich beim Eintritt in die Klinik sowohl psychisch als auch körperlich wirklich sehr krank. Wenn man sie nach ihren psychischen Problemen fragt, geben 72 Prozent an, dass sie sich ziemlich oder sogar sehr psychisch krank empfinden. Was die körperlichen Symptome betrifft, geben 45 Prozent der Patientinnen und Patienten an, dass sie sich körperlich ziemlich oder sehr krank fühlen.
Auch die Dauer der Beschwerden variiert stark, doch die Zahlen deuten oft auf eine hohe Chronifizierungsrate hin. So berichten beispielsweise 21 Prozent von einer Beschwerdedauer von bis zu einem Jahr, 16 Prozent von bis zu zwei Jahren, 25 Prozent von bis zu fünf Jahren und 39 Prozent sogar von zehn oder mehr Jahren.
Das sind erheblich lange Leidenszustände. Wie lange sind die Patientinnen und Patienten dann zur Behandlung in der Klinik?
Elisabeth Olliges: Das stimmt. Die Leidensdauer ist oft ziemlich lang. Unsere Zahlen zeigen, dass die durchschnittliche Behandlungsdauer bei 50 Tagen lag. Es gibt aber auch Fälle, in denen eine Behandlungsdauer von bis zu 173 Tagen notwendig war. Die im Durchschnitt längste Behandlungsdauer fällt auf die Gruppe der 16- bis 29-Jährigen.
Und was kann sich in diesem Zeitraum verändern?
Elisabeth Olliges: Die meisten Patientinnen und Patienten berichteten von einer Verbesserung ihrer Beschwerden: Die körperlichen Symptome reduzierten sich rechnerisch im Durchschnitt um 17 Prozent, während die psychische Gesamtbelastung um 27 Prozent abnahm. Erstaunlicherweise verringerte sich auch die psychisch-strukturelle Beeinträchtigung um 15 Prozent. Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, da in der Literatur häufig erst nach deutlich längeren Behandlungszeiträumen Veränderungen festgestellt werden konnten.
Könnten Sie genauer sagen, was sich für die Patientinnen und Patienten durch die psychosomatisch-psychotherapeutische Behandlung auf der Barmelweid verändert hat?
Elisabeth Olliges: Betrachtet man die Hauptdiagnose Depression, zeigt sich, dass die depressive Symptomatik während der Behandlung im Durchschnitt um 32 Prozent zurückging – ein wirklich beeindruckendes Ergebnis. Anders ausgedrückt, waren es bei Klinikeintritt nur 5 Prozent der Patientinnen und Patienten, die keine depressiven Symptome aufwiesen, stieg der Anteil bei Klinikaustritt auf 20 Prozent. Gleichzeitig sank der Anteil derjenigen mit einer mittelschweren Depression von 22 auf 11 Prozent, und der Anteil der Patientinnen und Patienten mit einer schweren Depression reduzierte sich von 37 auf 14 Prozent.
Lassen sich Gruppen von Patientinnen und Patienten identifizieren, die besonders profitieren?
Elisabeth Olliges: Unsere Erhebungen zeigen, dass insbesondere ältere Patientinnen im Sinne einer Reduktion der psychischen Gesamtbelastung profitierten, insbesondere der depressiven Symptome. Bezüglich der körperlichen Symptomatik zeigten vor allem Männer im Alter von 30 bis 45 Jahren sowie Frauen ab 60 Jahren deutliche Verbesserungen. Interessanterweise konnte bei Patientinnen und Patienten mit einer ausgeprägten Bindungsängsten, das heisst mit grossen Ängsten, eine nahe zwischenmenschlichen Bindung einzugehen, bedeutsame Fortschritte in der psychischen Gesamtbelastung erreicht werden, wiederum vor allem hinsichtlich der depressiven Symptomatik.
Und was sagen die Patientinnen und Patienten selbst, wenn sie die Klinik nach ihrem Aufenthalt wieder verlassen?
Reiner Dahlbender: Viele gehen deutlich gestärkt aus der Therapie hervor. Man kann sagen, wer sich auf das mehrdimensionale, milieutherapeutische Behandlungsangebot einlässt, welches das interprofessionelle Behandlungsteam zur Verfügung stellt, kann in der einen oder anderen Form profitieren. Wir stellen zum Beispiel. fest, dass Patientinnen und Patienten sich vielfach ein angemesseneres Verständnis ihrer Symptome, Beschwerden und Probleme erarbeiten konnten. Sie verstehen besser, wie ihre körperlichen Funktionen, ihr seelisches Erleben und ihre soziale Lebensgestaltung ineinandergreifen und leider vielfach dysfunktional zusammenspielen. Viele berichten, wie hilfreich für sie die Erfahrung war, vom Behandlungsteam wie auch von Mitpatientinnen und -patienten Zuwendung, Trost und Interesse erleben zu dürfen und immer wieder ermutigt zu werden, sich selbst besser kennenzulernen und eigene Wünsche und Lebensträume wieder oder neu zu entdecken. Manche mussten auch schmerzlich merken, dass sie die eigenen Ansprüche überdenken und gegebenenfalls anpassen müssen, um wieder vorwärts schauen zu können. Wiederum andere mussten begreifen, dass es an ihnen ist, Verantwortung für ihre eigenes Leben zu übernehmen und ihre persönliche wie berufliche Zukunft wieder aktiver zu gestalten.
Es ist wichtig, sich zu öffnen, oftmals Scham- und Schuldgefühle zu überwinden und über die eigenen inneren Nöte und schwierige Erlebnisse der Vergangenheit zu sprechen – darüber hinaus aber auch, zu verstehen, dass Reden alleine nicht ausreichend hilft, Lebensschwierigkeiten zu überwinden. Es braucht auch den Willen, manches anders zu machen und nicht selten auch den Mut, im Schutzraum der Behandlung, im Hier und Jetzt des stationären Milieus etwas ganz Neues auszuprobieren, sich dem anstrengenden Abenteuer einer Veränderung zu stellen, bis es körperlich, seelisch und zwischenmenschlich wieder besser passt.
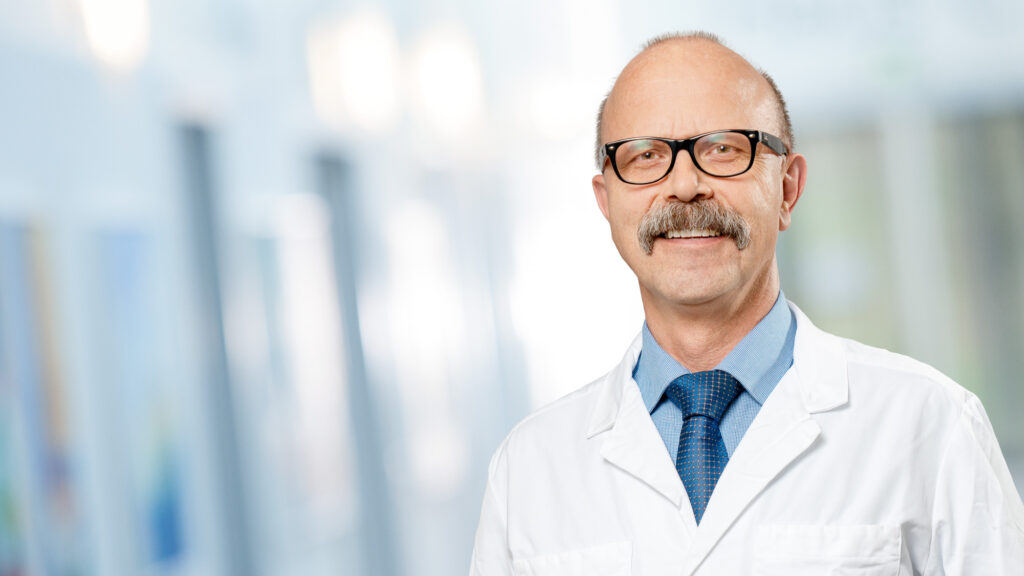
Bei allen Schwierigkeiten und zeitweiligen Rückschritten hatte diesen Mut beispielsweise eine junge Frau, die uns kürzlich eine sehr beeindruckende und berührende spontane Rückmeldung zukommen liess. Sie schrieb, dass sie oft an ihre Zeit in der Barmelweid zurückdenkt und jedes Mal aufs Neue erkennt, welchen enormen Fortschritt sie gemacht hat und wie gut es ihr geht. Sie trifft sich regelmässig mit Freunden und geniesst ihr Leben, sowohl im Ausgehen als mit ihrer Familie. Sie hat Hilfe von der IV angenommen und freut sich darauf, ihre Lehre zu beginnen. Sie ist zuversichtlich, dass sie die Lehre meistern wird. Ausserdem hat sie wieder Interesse daran, eine partnerschaftliche Bindung einzugehen. Sie beschloss ihre Mail mit dem Satz «Ich bin stolz auf mich. Ich weiss, wenn ich noch auf der Barmelweid wäre, würden Sie dasselbe sagen».
Wie lassen sich diese Ergebnisse insgesamt interpretieren?
Reiner Dahlbender: Die Auswertungen zeigen, dass der multiprofessionelle, mehrdimensional-milieutherapeutische Behandlungsansatz auf der Barmelweid selbst bei chronifizierten und körperlich «ausbehandelten» Patientinnen und Patienten eine spürbare Linderung bewirken kann. Insbesondere die grosse Gruppe von Patientinnen und Patienten mit funktionellen Beschwerden, bei denen organpathologische Störungen nicht im Fokus stehen, profitieren von der Therapie auf der Barmelweid. Und: Durch die gezielte Bearbeitung psychischer Probleme können auch körperliche (Begleit-) Symptome häufig reduziert werden.
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass auch Patientinnen und Patienten mit gravierenden psychisch-strukturellen Auffälligkeiten profitieren – und das, obwohl viele von ihnen bereits seit Jahren beeinträchtigt sind. Dies ist umso erstaunlicher, da die Behandlungsdauer angesichts der Schwere der Störung vergleichsweise kurz ist.
Vielen Dank für das Gespräch.